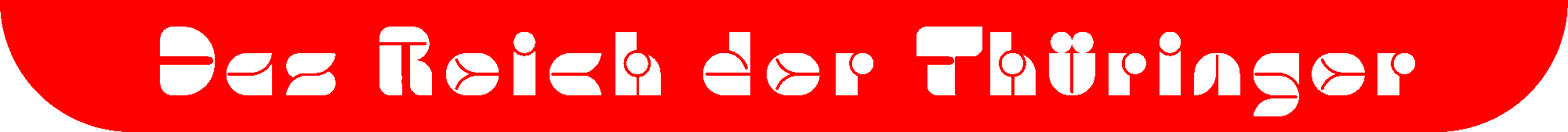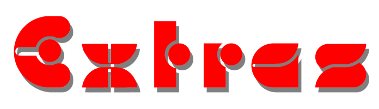




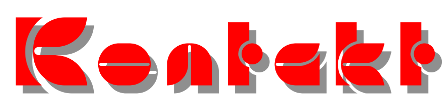

Der Text des folgenden Artikels darf verwendet werden unter der Lizenz CC-By-ND 4.0 int. (No Derivatives), das heißt: vollständige und unveränderte Wiedergabe mit Namensnennung Harald Küstermann, RoteSchnur.de .
Der Artikel ist auch verfügbar in einer druckerfreundlichen Version
Das Iring-Lied war ein althochdeutsches Helden-Epos aus der Zeit der germanischen Reichsgründungen und sein zwiespältiger Held Iring steckt tief drin in den Leiden und Tragödien der germanischen Sehnsucht nach einem eigenen Reich, einem germanischen Imperium.
Vom Reich der Thüringer berichtet das Iring-Lied. Die Thüringer waren neben den Alemannen, Sachsen und Franken einer der Stammesverbände, die um die Staatwerdung wetteiferten. Während Alemannen und Franken schon eng mit dem römischen Imperium zu tun hatten, lagen die Sachsen und Thüringer außerhalb der imperialen Grenzen. Gemeinsam war allen germanischen Stammesverbänden, dass ihre wechselnden Zusammenschlüsse unter der Eifersucht und Konkurrenz der Einzelstämme und ihrer Anführer litten. Schon die Markomannen hatten ca. 10 v.Chr. unter ihrem König Marbod ein Reich gegründet, das südöstlich von Thüringen etwa im heutigen Tschechien lag und das zeitweise so mächtig war, dass es auch nach dem Sturz Marbods 18 n.Chr. noch lange als Anreiz für weitere Reichsgründungsversuche wirkte. Armin der Cherusker hatte in der Varus-Schlacht 9 n. Chr. zwar drei römische Legionen vernichtet, schaffte es aber nicht, ein dauerhaftes Reich zu installieren. Cherusker und Markomannen bekriegten sich gegenseitig.
Die große Umformung von der Stammesgesellschaft zur Staatsgesellschaft dauerte Jahrhunderte und ging einher mit der religiösen Umwälzung von den Stammesreligionen zum Christentum. Bei den Alemannen war durch die iroschottischen Missionare die Christianisierung wohl am weitesten vorangeschritten. Die ehrgeizigen Merowinger beeilten sich zwar, ihr Frankenreich in der religiösen Entwicklung nach vorne zu bringen, aber ihre Motivation war nicht in erster Linie religiös, sondern sie hielten das Christentum für die römische Staatsreligion, womit sie beim keltisch geprägten Glauben der iroschottischen Nonnen und Mönche eigentlich an der falschen Adresse waren. Die römische Variante des Christentums war zu der Zeit noch schwach und unsicher. Mit solchen internen Unterschieden christlicher Strömungen hatten die Thüringer keine Erfahrung. Bei ihnen steckte die Christianisierung wohl noch ganz in den Anfängen.
Zur wichtigsten Christin aus dem Reich der Thüringer entwickelte sich Prinzessin Radegunde, Tochter des Königs Berthachar, also eine Generation jünger als Iring der verräterische Held. Falls der mit christlichen Symbolen verzierte Spangenhelm vom Gräberfeld Stößen zu König Berthachar gehören sollte, dann hätte Radegunde vielleicht schon von hause aus ein paar zarte christliche Impulse mitbekommen. Sie wurde als Elfjährige gemeinsam mit ihren beiden Brüdern, nach der verlorenen Schlacht an der Unstrut, von den Siegern ins Frankenreich verschleppt, erhielt dort ihre christliche Erziehung und wurde ein paar Jahre später mit dem Frankenkönig Chlothar zwangsverheiratet, wohl um die Einverleibung des Thüringer Erbes ins fränkische Königtum sicherzustellen. Damit schien ihr Schicksal als ausgeliefertes Beutestück besiegelt, denn an ihr als Königstochter hingen potentielle Erbschaftsansprüche. Ihre hohe Abstammung wurde so zu ihrem Verhängnis. In Radegundes Widerstandskraft aber hatten sich die Merowinger verschätzt. Ihrem königlichen Zwangsehemann ist die Thüringer Prinzessin davongelaufen. Als scheinbar machtlose und unstete Ex-Königin fand sie Zuflucht in wechselnden iroschottischen Klöstern und von der Klosterkultur aus entfaltete sie überraschenderweise einen beträchtlichen Einfluss auf Gesellschaft und Königshaus. Die in den Augen der Merowinger wehrlose Take-Away-Prinzessin hatte sich in eine stachelige, kulturschaffende Run-Away-Königin verwandelt. Radegunde wurde zu einer der am meisten verehrten Heiligen im ganzen Merowinger-Reich. Die fränkischen Königshäuser mussten der Davongelaufenen Respekt zollen. Die Volksseele der Thüringer aber wollte nicht mitlaufen mit der christlich gewordenen Run-away-Emanze, sondern blieb hängen in Iring dem Helden, "so schlau und wortgewaltig wie löwenkühn". Der Stolz des Volkes klebte und klebt am verlorenen Reich. Deshalb müssen wir zurückgehen zu den Anfängen.

Fibeln aus dem Fürstinnengrab im Gräberfeld Hassleben ca. 300 v.Chr.. Foto: CC-BY-NC-SA Brigitte-Stefan Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens
Die prächtigen archäologischen Funde aus den Fürstengräbern von Haßleben und Leuna zeigten schon um 300 n.Chr. eine stolze Fürstenkultur, die im folgenden Jahrhundert gemeinsam mit den zugewanderten Angeln und Warnen den Verband der Thüringer bildete.
Odoaker, der weströmische Offizier und seit 476 n.Chr. Herrscher (rex und patricius) über die Reste des Weströmischen Reiches, stammte väterlicherseits aus Thüringen und wird in manchen Quellen auch schon als "Torcilingorum rex", König der Thüringer tituliert, allerdings im Heeresverband der Hunnen, unter der Oberherrschaft Attilas.
Zeitweise war also der Stammesverband unter die Herrschaft Attilas geraten, aber nach dem Zusammenbruch der Hunnenherrschaft um 453 n.Chr. entwickelten die Thüringer ihr eigenes Königreich. Von den Thüringer-Königen als erster namentlich gesichert gilt Bisinus, der um 500 n.Chr. dort herrschte. Das Reich der Thüringer war zu seiner besten Zeit wohl eines der mächtigsten Germanenreiche. Es erstreckte sich im Kern über weite Teile der heutigen Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die darüberhinausgehenden Herrschaftsbereiche sind umstritten. Schon eine Generation später aber ging dieses beeindruckende Reich mit der verlorenen Schlacht an der Unstrut (531 n.Chr.) zugrunde und wurde dem fränkischen Reich der Merowinger einverleibt.
Neben dem Iring-Lied ist auch "Das Klagelied der Radegunde" (Vom Untergang Thüringens) eine wichtige Quelle zum Untergang des Thüringer-Reiches. Die thüringer Prinzessin war eines der ersten und vorallem das berühmteste Opfer jener dramatischen Vorgänge. Der Kämpfer Iring aber wollte keinesfalls Opfer sein, sondern viel lieber Täter großer Taten, egal wie unmoralisch sie sein sollten. Der Held des nach ihm benannten Iring-Liedes ist alles andere als christlich. In seiner Schlauheit, Kampfstärke und Skrupellosigkeit gleicht Iring ganz den Merowingern, gegen die er eigentlich im Auftrag des Thüringer Reiches zu kämpfen hatte.
Die Zufälle der Geschichte oder die bittere Tragik des Helden besonders aber die zwiespältige Trauer über den Untergang des Reiches führten dazu, dass die Weitergabe und Pflege des Helden-Liedes nicht mit der nötigen Sorgfalt erfolgte. So existieren von diesem wichtigen Epos nur noch Bruchstücke, die in frühmittelalterlichen Handschriften überliefert wurden. Am ausführlichsten werden Teile des Helden-Liedes zitiert in den von Widukind von Corvey verfassten "Res gestae Saxonicae" (Geschichte der Sachsen). Eine knappere Zusammenfassung findet sich in den Quedlinburger Analen.
Das Iring-Lied beginnt mit einem Erbschaftsstreit. Amalberga, die Frau des Thüringer-Königs Irmenfried, stammt - laut Iring-Lied - aus fränkischem Königshause. Anlässlich des Todes von Frankenkönig Chlodovech, stachelt Amalberga nun ihren Mann dazu an, Ansprüche auf fränkisches Erbe geltend zu machen. Das Haupterbe als Thronnachfolger hatte sich Amalbergas Halbbruder Dietrich gesichert. Vielleicht einen Happen vom Frankenreich abzubeißen, war für die Thüringer ein ehrgeiziges Ziel, dazu reizte Amalberga ihren Gatten Irmenfried, und da kommt Iring ins Spiel, "ein Mann ebenso schlau und wortgewaltig wie löwenkühn". Er ist der Ratgeber des Irmenfried und Amalberga benutzt ihn für die Einflüsterung, dass ihr Halbbruder Dietrich, der Möchtegernnachfolger auf Chlodovechs Thron, doch nur der Sohn einer Magd sei, also nur halb so königlich wie Amalbergas Erbanspruch. Iring macht seine Sache gut, im Sinne von Amalberga. Irmenfried legt sich mit Dietrich an, indem er dessen Boten zurückschickt mit der Aufforderung, Dietrich solle selber kommen und einen Haufen "roter Ringe", also Goldgegenstände, mitbringen, um sich von Amalbergas Erbrecht freizukaufen. Der fränkische Gesandte antwortet drohend: "Mein Herr wird kommen, wie du wünschest, König Irmenfrid, und wenn sein Gold nicht schwer genug ist, so legt er dir noch einen Berg von Thüringerköpfen auf die Wage!" Das war praktisch schon die Kriegserklärung.
Fast könnte einem der Thüringer-König leid tun, wie er so von seiner typisch-tückischen nämlich fränkischen Gattin ins gefährliche Spiel geschickt wird. Das Mitleid lässt sich begrenzen. Irmenfried ist längst nicht so friedlich, wie es sein Name verheißt, er hatte davor schon seine beiden Brüder und Mitkönige Berthachar (Radegundes Vater) und Balderich beseitigt, um alleine das Thüringer Reich zu regieren.
Irmenfried besaß also im eigenen Reiche Erfahrung mit Erbschaftsfragen und schon dabei war seine Gattin Amalberga als Ideengeberin behilflich gewesen. Übrigens auch Irmenfrieds Schwager Dietrich hatte da bereits eine Rolle gespielt, nämlich als Bündnispartner gegen Irmenfrieds Bruder Balderich. So hatte Irmenfried seine Alleinherrschaft im Reich der Thüringer auch der fränkischen Unterstützung zu verdanken. Jetzt aber war Schwager Dietrich der Gegner.
Erbschaft und Erbschaftstreit, Verwandtschaftsbeziehungen und Verwandschaftskonflikte sind typische Themen von Stammesgesellschaften, wo alle Rechte und Pflichten, alle Rollen und Identitäten entlang der Abstammung verteilt werden. Die frühen Königreiche hängen noch ganz fest in den Stammesthemen und auch die später daraus gewordene Feudalgesellschaft bleibt in der Führungsschicht stammesgesellschaftlich. Abstammung bestimmt die Rollenverteilung. Sage mir, wer deine Eltern sind, dann weiß ich wer du bist. Der Verwandtschaftsgrad bestimmt deine Rechte und Pflichten einem jeden anderen Gesellschaftsmitglied gegenüber. Allgemeingültige Freiheiten und Gesetze gibt es noch lange nicht. Eigenständige Identität für jeden einzelnen Menschen und Rollenzuordnung nach individuellen Fähigkeiten stehen noch in weiter Ferne. Nur bei Iring stehen die individuellen Fähigkeiten im Vordergrund. Der Mann "ebenso schlau und wortgewaltig wie löwenkühn", wird wegen dieser Eigenschaften ins dramatische Rennen geschickt, nicht wegen seiner Herkunft. Iring gewinnt Geltung als Individuum, nicht durch Abstammung und somit ist er die modernste Figur im ganzen Epos.
Es kommt zum Krieg zwischen den beiden Reichen, besser gesagt: Stammesverbänden. Dietrich mit seinen Franken und sächsischen Verbündeten gewinnt. Aus der verlorenen Schlacht an der Unstrut hat sich Irmenfried noch in die Veste Scheidungen retten können, und als Unterhändler für die Kapitulationsverhandlungen wird Iring losgeschickt. Schlau und skrupellos besticht der Thüringer heimlich die Ratgeber Dietrichs und als das wenig hilft, beruft er sich auf familiäres Mitleid, Dietrich solle doch mit seiner Schwester Amalberga fühlen und ihr Leid nicht unnötig vermehren.
Zum Schein geht Dietrich darauf ein mit dem Zugeständnis, das Leben seines Schwagers und königlichen Konkurrenten Irmenfried zu schonen, wenn dieser sich formal ihm unterwerfe. Iring könnte also mit gutem Verhandlungsergebnis zu seinem König zurückkehren. Das Reich der Thüringer wäre zwar untergeordnet dem fränkischen, würde aber immerhin weiterbestehen und Irmenfried dürfe am Leben bleiben, als neuer Gefolgsmann des Dietrich. Das scheinen doch erträgliche Friedensbedingungen zu sein.
Bevor aber Iring das Lager der Franken verlässt, nimmt Dietrich ihn beiseite, schmeichelt ihm, dass er ihn gerne in fränkische Dienste übernehmen würde, bei den Thüringern gäbe es doch keine Zukunft. Für einen besonderen ersten Auftrag wurden dem Iring haufenweise rote Ringe und hohe Ehren versprochen. Wenn Irmenfried vor Dietrich niederknie, wie es als Symbol der Unterwerfung, Verlierer vor dem Sieger tun, dann solle er, Iring, dem Knieenden das Haupt spalten. Seinen eigenen König soll er töten, das wird vom Helden verlangt, damit seine eigene Zukunft rosiger aussähe. Die Treue zu seinem König soll er über Bord werfen, sich vom Verlierer trennen und überlaufen zu den Siegern. Auf der Seite der Gewinner zu stehen, das ist der Lohn, der ihm versprochen wird, für einen Verrat an den Thüringern und an seiner eigenen Vergangenheit. Wozu sollte er, als Einzelner, Moral und Ehre aufrecht halten, wenn um ihn herum nur List und Heimtücke regierten? Iring ist sich selbst der Nächste und lässt sich von Dietrich kaufen.
Von einem anderen Merowinger-König ist überliefert, dass er nach einer siegreichen Schlacht beim Beuteverteilen einen goldenen Krug an sich riss, den aber schon einer seiner Gefolgsleute für sich reserviert hatte. Als dieser Unglückselige zu protestieren wagte, setzte sein König ihm die Axt zwischen die Augen. Für ein Stück Beute ist dieser König bereit, seinen Gefolgsmann nicht nur irgendwie zu opfern, sondern ihm eigenhändig den Schädel zu spalten. Diese Moral der germanischen Königreiche gehört weder zum Stamm noch zum Staat, sondern zur dritten grundlegenden menschlichen Gesellschaftsform nämlich zur Räuberbande. Nicht nach familiären Pflichten und Rechten wird dann gehandelt und auch nicht nach vereinbarten, für alle gültigen Gesetzen, sondern allein die Macht und die Durchsetzungskraft entscheidet. Einzig der Erfolg zählt, keine sonstige Moral, keine Treue zu irgendwem, keine Ehre in irgendeinem anderen Maßstab.
In der Bande wird nicht der Sohn des Häuptlings Häuptling, auch nicht der oder die Klügste und Tüchtigste in einem gleichberechtigten Auswahlverfahren, sondern ganz ohne Rücksicht auf Verwandtschaft oder Regeln, ohne Rücksicht auf Stamm oder Staat, reißt einfach der Fieseste, Schnellste, Brutalste die Führungsrolle an sich. Der Rückfall in diese Gesellschaftsform steht als Option immer zur Verfügung, wenn Menschen sich an die Verbindlichkeiten keiner der beiden anderen Formen mehr halten. Die Bande ist die natürlichste und kurzlebigste der drei Gesellschaftsformen. Keine Sicherheit, kein Friede, keine Wahrheit kann in dieser Form entstehen. Immer auf der Lauer, immer im Misstrauen muss jeder in der Bande leben. Ein Räuberhauptmann kann nicht einmal friedlich in Rente gehen, weil sein Nachfolger sonst immer Angst haben müsste, vor der Wiederkehr. Die dystropische Zerfallsform jeder menschlichen Gesellschaft ist die Bande in all ihren Variationen.
(die einzelnen Textstellen zitiert nach Gustav Neckel:)
Und als nun Irmenfried kam und vor Dietrich kniete,
da hob Iring, der neben diesem stand, sein Schwert
und spaltete dem Knienden das Haupt.
Als fieser Verräter erscheint so zunächst der Held Iring, tötet seinen eigenen König. Tiefe Verachtung müsste diesen Helden strafen für seine Treulosigkeit. Anstelle der Verachtung durch das Publikum, kommt dann aber im Iring-Lied eine andere Strafe: Iring wird seinerseits Opfer des Verrats: Der Frankenkönig Dietrich denkt gar nicht daran, Iring die versprochene Belohnung zu geben, samt Übernahme in fränkische Dienste, sondern:
Dietrich rief, so dass alle es hörten: "Diese Neidingstat wird dir niemand lohnen; ich habe nichts mit dir gemein; sei froh, wenn du heil von hinnen kommst!"
Dietrich entrüstet sich öffentlich über die Tat, die er zuvor heimlich selbst in Auftrag gegeben hatte. Der Initiator des Mordes beschimpft seinen Auftragskiller, um die eigene Intrige zu vertuschen und sein königliches Prestige zu wahren. Auf dem Höhepunkt der Iring-Sage wird so die abgrundtiefe Unmoral des Merowingers bloßgestellt. Der Dichter dieses Liedes steht irgendwie noch immer auf der Seite der Thüringer und verachtet die Franken. Die Unmoral seines thüringischen Helden verschweigt er keineswegs, aber sie wird noch unterboten durch die schlimmere Unmoral der Merowinger. Noch mitten im tragischen Untergang, gibt der Dichter seinem Helden Iring, dem verratenen Verräter, dann den letzten Kick. Jetzt erst lässt er Iring seine eigentliche Heldentat begehen:
Erhobenen Hauptes antwortete Iring: "Wohl bin ich ein Neiding, aber deine Ränke haben es gemacht. Wohlan, mein Herr soll nicht ungerächt liegen!" Und mit dem Schwerte, das er noch blutig in der Hand hielt, schlug er den Frankenkönig zu Boden. Über seinen Leichnam legte er den toten Irmenfried, "damit der wenigstens im Tode siege, der im Leben unterlag. Und mit dem Schwerte sich eine Gasse bahnend, ging er davon."
Ist das ein Rückfall Irings in die schon verlorene Königstreue oder ist es pure Verzweiflung? Rächt er seinen toten König oder rächt er nur sich selbst? Ist Rache die letzte und einzige Genugtuung für den Verlust jeder Moral und den ganzen desaströsen Schlamassel? Der Vergleich zwischen Iring-Lied und der tatsächlichen Geschichte, wird noch eine andere Auslegung erforderlich machen.
Andere Quellen als das Iring-Lied erzählen andere Versionen vom Thüringer Reich und seinem Untergang. Nicht im Heerlager der Franken sei der Thüringer König durch einen Schwerthieb gestorben, sondern auf eine Burg sei er gelockt und dort über die Mauer gestoßen worden, ob von einem Verräter aus den eigenen Reihen oder von den fränkischen Schergen, ist dabei nicht so klar. Verrat war es so oder so, die Kapitulationsvereinbarung wurde gebrochen. Auch über die Gattin des Thüringer Königs gibt es andere Berichte. Nicht als fränkische Schwester Dietrichs, sondern als Nichte eines ostgotischen Königs wird Irmenfrieds Gemahlin Amalberga dort eingeordnet. Und diese andere Verwandtschaftszuordnung ist glaubwürdiger, denn dorthin, ins Reich der Ostgoten in Italien flieht Amalberga tatsächlich mit dem Sohn Amalafried nach der Niederlage der Thüringer. Mit Langobarden und Ostgoten hatten die Thüringer wohl Bündnisse und die Königsfamilie der Thüringer findet Asyl im Süden im Reich der Ostgoten. Der Dichter des Iring-Liedes hatte sie vielleicht nur aus dramaturgischem Interesse zur Fränkin gemacht. Historisch ungeklärt sind immer noch die Lage der Königshöfe des Thüringer Reiches ebenso wie der genaue Ort jener verhängnisvollen Schlacht an der Unstrut. Auch die Burg Scheidungen, als Fluchtort der Thüringer ist umstritten, andere Burgen scheinen historisch eher diesen Anspruch erheben können. Angesichts der dichterischen Freiheit des Iring-Liedes, könnte es sein, dass die dramatische Heldenszene am Schluss pure Erfindung ist. In Wirklichkeit nämlich lebte Dietrich nach der Unstrut-Schlacht weiter, kein thüringischer Held schlug den Franken zu Boden. Keiner hat den toten Thüringer König obenauf gelegt. Keiner hat die Thüringer gerächt. Und keiner ging mit dem Schwerte sich eine Gasse bahnend aus dem Kriegslager der Franken davon. Der Held Iring ist zumindest in dieser Szene ein Wunschtraum, eine Illusion, eine Fiktion.
Der Untergang des Thüringer Reiches wirkt lange fort nicht nur in Geschichten und Dichtungen, sondern auch in den tatsächlichen Machtkämpfen nach dem Tod der Thüringer Könige. Radegunde und ihr Bruder hatten wohl Hoffnung auf eine Wiederauferstehung des Thüringer Reiches in Verbindung mit einen Aufstand der Sachsen und Thüringer gegen die fränkische Herrschaft im Jahr 555 n.Chr.. Der Aufstand scheiterte und Radegundes Bruder wurde umgebracht, aber in den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Eigenwilligkeiten aus Thüringen bis hin zur Verschwörung Hardrads gegen Karl den Großen 785 n.Chr.. Das Thüringer Reich hatte also Wurzeln in der Kultur des Volkes und war nicht einfach das aufgesetzte Projekt einiger Ehrgeizlinge, sonst wäre es mit diesen sang- und klanglos von der Bildfläche verschwunden. Weit über die Grenzen Thüringens hinaus wurde die Schlacht an der Unstrut und ihre Folgen von den Zeitgenossen in der ganzen christlichen und heidnischen Welt mit Entsetzen wahrgenommen. Der Untergang dieses Königreiches wurde mindestens genauso dramatisch und traumatisch empfunden, wie der Untergang des Burgunder Reiches, auch wenn das Nibelungenlied später größere Berühmtheit erlangte als das Iring-Lied. Die mit dem Thüringer Reich verbundenen Gefühle und Hoffnungen sind noch immer nicht geklärt und noch lange nicht angemessen betrauert worden. Nur durch Trauer würde die in der Vergangenheit verhangene Energie befreit und für das Leben zurückgewonnen werden. Unbetrauert verwandelt sich diese Energie in einen verrückten Hass, der in ewiger Wiederkehr des Verdrängten sich auf das aktuelle Leben projeziert. Die ausweglose Zersetzung jedweder Moral wird in kollektiver Verrückheit immer aufs Neue zelebriert.
Durch welche Serpentinen wird die Volksseele geführt in diesem Helden-Epos? Und wo ist sie hängen geblieben, die Volksseele der Thüringer, der Sachsen und der Anhaltiner? Iring als Identifikationsfigur trägt in sich die Verzweiflung über den Untergang eines stolzen Reiches und das Verlangen nach Rache. Die eigene Mitschuld wird nicht geleugnet, aber "die Franken" sind die Hauptschuldigen und sie kommen mit ihren Gemeinheiten, Treulosigkeiten und Ehrlosigkeiten in der wirklichen Geschichte scheinbar ungestraft davon. Die Franken schaffen "das Heilige römische Reich deutscher Nation". Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und somit auch nach Rache wird nicht befriedigt durch den späteren Untergang der Merowinger-Dynastie und die Übernahme des fränkischen Reiches durch die Karolinger. Im Gegenteil, es könnte sein, dass der Hass auf die Franken durch die Karolinger erst richtig angefacht wurde, da sie an Skrupellosigkeit ihren Vorgängern nicht nachstanden und an Erfolg jene sogar noch übertrafen. Das scheinbar einfache Feindbild wird dadurch kompliziert, dass die Thüringer genau dieselben Ziele und denselben Ehrgeiz hatten, wie die konkurrierenden Stammesverbände. Das Imperium der Römer zu beerben und im Glanze der Geschichte dazustehen. Der stolze Erfolg des fränkischen Imperiums zieht alle seelischen und geistigen Kräfte auf sich. Wenn nur der Erfolg zählt, und alle Moral dafür in den Wind geschlagen wird, dann müsste das ganze Wir-Gefühl hinüberwechseln auf die Seite der Sieger. Den puren Erfolg bar aller Moral haben die Stammesverbände zum Maßstab ihres Handelns gemacht. Wäre der Erfolg schon die ganze Wahrheit, dann müssten wir alle uns identifizieren mit dem tollen römischen Reich regiert von Karl dem Großen. Wir müssten schwelgen im stolzen, germanischen Gefühl: Wir sind Kaiser, wir sind Cäsaren, wir sind Imperatoren. Der Held Iring repräsentiert dagegen die regionalen und stammesmäßigen Gefühlszugehörigkeiten der Beinahe-aber-dann-doch-nicht-zum-Zuge-gekommenen. Er repräsentiert die Frustrationen der Benachteiligten, der Unterlegenen, der Verratenen und Verlierer und damit auch das Rachebedürfnis gegen die Sieger. Dafür aber hat er keinen moralischen Anspruch, den er anmelden könnte. Genau diese Gefühle ebenso wie ihre Träger, die Benachteiligten, die Unterlegenen, die Verratenen und Verlierer haben wir gelernt zu verachten. Genau dieser ausweglose Zwiespalt zwischen bedingungslosem Glauben an den Erfolg auf der einen Seite und Hass und Rachegelüste gegen die Erfolgreichen auf der anderen Seite führt in den Wahnsinn und führt in die Dystropie.