

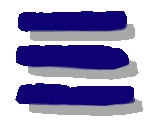 1 Ebenbild Gottes -
2 Ebenbild Gottes -
3 Ebenbild Gottes -
4 Frühgeburt -
5 Ich -
6 simul iustus et peccator -
7 Sigmund -
8 Freud -
9 Weiteres Material -
1 Ebenbild Gottes -
2 Ebenbild Gottes -
3 Ebenbild Gottes -
4 Frühgeburt -
5 Ich -
6 simul iustus et peccator -
7 Sigmund -
8 Freud -
9 Weiteres Material -
Menschenwürde statt Königswürde! Das ist die zentrale Aussage der biblischen Schöpfungserzählung. Warum hat es so lange gedauert, bis die Bibelauslegung diesen Skopus herausgearbeitet hatte? Antwort: Die Bibelauslegung hängt in ihren eigenen Befangenheiten. Der Text wurde nicht als Konfliktstoff gegen die Königsideologie gelesen, sondern immer als hochehrwürdige Theorie eines immerwährenden Weltbildes. Weil das Christentum selbst anderthalb Jahrtausende lang als Staatsreligion benutzt wurde, also Königsideologie lieferte, war die Interpretation gefangen in diesem Horizont. Die vermeintliche Schöpfungsordnung festzustellen war das Ziel der Bibelauslegung, nicht die Kritik an den Königen. Weltordnung war die Brille, anstelle von Subversion der Gesellschaftsordnung. In diesen anderthalb Jahrtausenden seines Daseins als Staatsreligion hat das Christentum gründlich verlernt, zwischen Weltordnung und Gesellschaftsordnung zu unterscheiden.

Christentum im Mittelalter: "Von Gottes Gnaden" wurde die Formel für die Legitimierung von Herrschaft. Verloren war die Formel für die Menschenwürde.
Ein großer Schritt: Das Konzil von Nicäa 325 n.Chr. Die Kirche wird legal
Viele Teilnehmer an dem vom Kaiser einberufenen Konzil trugen noch die Spuren der Folterungen von der letzten großen Christenverfolgung am eigenen Leibe. Manchen waren Augen ausgestochen worden, manchen hatten die imperialen Behörden Sehnen durchschnitten. Narben von Auspeitschungen und Verbrennungen, sowie Gesundheitsschäden von der Zwangsarbeit in den Bergwerken gehörten zu den Mitbringseln der christlichen Delegationen, als sie in Nicäa auf Einladung des Kaisers über die Zukunft der Kirche verhandelten. Das Konzil von Nicäa markiert das Ende der Verfolgungen. Das Christentum war jetzt nicht mehr illegal, aber die Legalisierung forderte einen Tribut. Die Machthaber wollten eine überschaubare, kontrollierbare Kirche in ihrem Imperium haben. Die kirchliche Organisation sollte einheitlicher und hierarchischer werden. Statt offener, bunter Diskussion sollte die Lehre aus festgelegten Dogmen bestehen, klar definierte Befehlsgewalt statt chaotischem Palaver. Und die Kirche ließ sich darauf ein. Vor Nicäa war das Christentum im römischen Reich eine subversive, anti-imperiale, unberechenbare Macht gewesen. Nach Nicäa war das Christentum auf dem Wege, die Reichsreligion zu werden. Der Staat gab nach, aber um welchen Preis? Gleichschaltung ist hierfür zwar ein anachronistischer Begriff, aber dem Wortlaut nach nicht ganz unzutreffend. Weitere Schritte in den folgenden Jahrhunderten waren die Erhebung zur Staatsreligion, noch im Imperium Romanum, dann die Nachfolge-Reiche der germanischen Könige, besonders der Merowinger, die das Christentum bereits als Staatsreligion kennenlernten und es nur so verstanden.